
Wenn Ideale zur Norm werden
1981 wurde ich umgeschult. Wir waren die „schwierige Klasse“ einer durchschnittlichen Grundschule. Nachträglich zusammengestellt aus zurückgestuften, zugezogenen und von den jeweiligen Klassenlehrerinnen aussortierten Zweitklässlern. Migrationshintergründe, Essstörungen, ADHS, Legasthenie, Dyskalkulie, Transidentität, Hochbegabung, Depressionen und Sozialphobie waren als Begriffe noch nicht im allgemeinen Bewusstsein verankert. Darum waren wir – obwohl wir sämtliche Symptome zum Besten gaben – nur Sonja, Kemal, 3x Claudia, Eduard, Azur, Kristina, Adiyemi, 1falt … mehr oder weniger angepasst mit mehr oder weniger vorzeigbaren Noten.
Rückblickend denke ich schon, dass es für die Hand voll Vertretungslehrerinnen (die Klassenlehrerin wurde rechtzeitig schwanger) nicht immer leicht war, uns etwas beizubringen. Geklappt hat es trotzdem. Das Durchschnittsalter im Lehrerzimmer lag deutlich über 50. Man hatte schon so viele randalierende Siebenjährige er- und überlebt, dass eine konzeptbefreite Pädagogik der Gelassenheit den Schulalltag bestimmte. Unsere Eltern kamen aus Russland, Polen, Nigeria, Deutschland und der Türkei, waren jüdisch, muslimisch, katholisch, protestantisch, evangelikal und atheistisch, hatten viel, genug oder wenig Geld, viel, genug oder wenig Arbeit, viel, genug oder wenig Interesse an ihren Kindern. Nach der Schule spielten wir auf der Straße, auf Baustellen, Spiel- und Bolzplätzen.
Wenn ich überlege, was ich in dieser Zeit (neben Lesen, Schreiben, Rechnen, Völkerball) gelernt habe, ist es, dass Menschen so unterschiedlich sind, dass es viel mehr Sinn macht, sich zu ergänzen und gegenseitig zu helfen als miteinander zu wetteifern.
Wahrscheinlich lassen sich meine Erfahrungen nicht verallgemeinern. Schließlich war unsere Außenseiter-Klasse eingebettet in eine gut situierte Spießeridylle mit gepflegten Vorgärten und gestärkten Gardinen. Wir lebten nicht in einem sozialen Brennpunkt und wenn doch, verbrachten wir die meiste Zeit in Familien, bei denen es offene Türen und Mütter mit Schürzen gab, die gerne auch mal andere Kinder bekochten.
Vor allem aber lassen sich meine Erfahrungen nicht auf die heutige Zeit übertragen. Denn neben all den oben aufgeführten Festschreibungen individueller Leistungs(-un)fähigkeit fehlte vor allem der heute allgegenwärtige Leistungsdruck. Ein Leistungsdruck, der nicht nur auf den Kindern, sondern auch auf Eltern und Lehrern lastet. Der sich in Ausbildung, Arbeits- und Beziehungsalltag fortsetzt.
Wenn nur das Beste gut genug ist, wird alles erklärungsbedürftig, was nicht perfekt ist. Dann braucht es für jede Leistung, die keine Bestleistung ist, eine Begründung. Dann ist alles krank, was nicht dem Ideal entspricht.
Wenn also Ideale zur allgemeinverbindlichen Norm werden, erzeugt jede Unvollkommenheit auch individuellen Leidensdruck. Dann wird alles zum persönlichen Versagen, was nicht perfekt ist. Darum braucht es den Fachbegriffe für vermeintliche Fehlfunktionen, um zu erklären, dass Perfektion im Einzelfall nicht erreichbar ist.
Natürlich ist es gut und löblich, dass auf all diese „Defizite“ helfend, fördernd und maßgeschneidert eingewirkt wird. Das ändert aber nichts daran, dass immer mehr Menschen in dem Gefühl aufwachsen defizitär zu sein.
Das ist keine neue Erfindung.
Jahrhunderte haben sich Menschen als sündig empfunden und in Scham gelebt.
Sie haben zwischen Todsünden, Erbsünden, lässliche Sünden unterschieden, ausufernde Sündenlisten und Bußkataloge erstellt.
Ich sehe keinen – wirklich keinen – Grund an diese Traditionen anzuknüpfen.
Foto: Traveler_40
Der Vollständigkeit halber hier der anstoßgebende Wortwechsel auf Twitter:
https://twitter.com/Erdrandbewohner/statuses/470113025467629568
https://twitter.com/Erdrandbewohner/statuses/470127489361403904
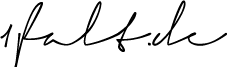
Leider kann ich deine Erfahrungen nicht teilen. Ich wurde in den 70ern eingeschult. Zu einer Zeit also, als ADHS noch HKS oder MCD hieß und eine Rechenschwäche bzw. eine Rechtschreib-Leseschwäche landläufig mit Minderbemittlung oder gar Behinderung gleichgesetzt wurde.
Und so wäre ich beinahe auf einer Schule für Lernbehinderte gelandet, denn ich habe eine Dyskalkulie, was damals von einer Kinderpsychologin auch diagnostiziert wurde. Nicht diagnostiziert hat sie bei mir ADHS, weil ich die für Jungs eher seltenere Träumer-Variante (in meinem Fall mit wenig Hyperaktivität nach außen, dafür eine innere Unruhe und Anspannung) habe. Das wurde erst 30 Jahre später festgestellt, als ich wegen dem Eigenverdacht auf eine Abklärung bestand. Und hätte die Kinderpsychologin nicht auch meine Intelligenz getestet und für sehr überdurchschnittlich befunden, dann wäre ich trotz hohem IQ, nur weil ich Dyskalkulie und ein nicht erkanntes ADHS habe, tatsächlich auf einer Schule für lernbehinderte Kinder gekommen. Ein Studium, welches ich mir später trotzdem noch hart erkämpfen musste, wäre mir verschlossen geblieben. Wahrscheinlich hätte ich als „Sonderschüler“ nicht einmal eine Lehrstelle bekommen…
Ich weiß, wie es sich anfühlt, einfach so „anders“ zu sein, ohne daß es eine Erklärung dafür gibt. Ich weiß, wie es sich anfühlt, weil man an sich verzweifelt, weil man trotz hoher Intelligenz immer wieder an den selben Dingen scheitert, ohne zu wissen, warum.
Und ich weiß, wie es sich anfühlt, plötzlich eine Erklärung für all dies und noch mehr zu bekommen. Das ist eine unglaubliche Erleichterung. Ein neues Leben. Ich konnte aufhören zu kämpfen und lernen, mit meinem ADHS umzugehen und zu dem zu werden, was ich eigentlich war und bin.
Da ist keine Sünde und Scham. Im Gegenteil. Nur Erlösung, weil es einen Namen gibt, weil ich mich endlich so annehmen kann, wie ich bin.
Danke für den Tweet und auch den Beitrag.
Ja, ich habe es auch als positiv empfunden, wie es Erdrandbewohner schreibt, einen Namen für das Kind zu haben: Essstörung.
Aber noch lieber wäre es mir gewesen, wenn ich von Anfang an in meiner Werdung pädagogische Fachkräfte als LehrerInnen gehabt hätte, die mich in meinem Leben begleitet hätten. Die immer, wenn meine naturwissenschaftlichen Eltern überfordert waren, mit mir Dinge hätten herausarbeiten können.
Die gewußt hätten, wie man Kindern das Gefühl gibt, genau so gut zu sein, wie sie sind und die Unterschiedlichkeit als Ergänzung zu vermitteln und nicht als Faktor, der uns in „Gut“ und „Reicht leider nicht um vernünftig zu leben“ einteilt.
Danke für deine Gedanken, die mich immer wieder selber in Frage stellen, was wichtig ist, denn je länger mein Leben, desto eingefahrener werden viele Gedanken.
Danke!
Wahrscheinlich ist es nicht möglich, eine Entwicklung in Frage zu stellen, ohne damit auch persönliche Erfahrungen zu streifen. Dennoch liegt es nicht in meiner Absicht, individuelle Dignosen anzuzweifeln, die als befreiend erlebt wurden. Ganz im Gegenteil. Die Erleichterung, endlich so gesehen zu werden, wie man sich selbst erlebt, macht ja gerade deutlich, wie wenig verallgemeindernde Maßstäbe in der Lage sind, Individuen angemessen abzubilden und zu begleiten.
Es geht mir nicht darum Besonderheiten zu nivellieren oder unter den Tisch zu kehren – ich möchte sie nur nicht als Krankheit verstanden wissen.
Der Link von @Karin bringt es gut auf dem Punkt:
[…] besonders: der steuerberater war da. wahrscheinlich wird unser verein eine gmbh. vielleicht ist das ehrlicher. ich weiß nur noch nicht, wem gegenüber. […]