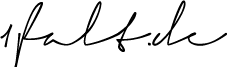Angst vor Liebe
In ihrer (sehr lesenswerten!) Herzterz-Kolumne nennt Frau Wagener die Liebe „Das größte Monster unterm Bett“ und fragt, warum wir fürchten, wonach wir uns sehnen.
Neben anschaulichen Beispielen für das „Zeitgeistphänomen Angst vor der Liebe“ legt sie zwei Interpretationen nahe:
1. Angst vor der vorschnellen Entscheidung für eine(n) gegen alle anderen.
2. Angst vor Verletzung.
Ihr abschließendes Fazit und mutmachendes Plädoyer für das Wagnis Liebe:
Wer Angst vor der Liebe hat, der hat letztlich auch Angst vor dem Leben.
Und: Ja, dieser Konklusion stimme ich zu! Denn als versierter Angsthase habe auch ich gelernt: Fasse Dir beizeiten ein Herz, Vermeidung macht die Angst nur größer!
Kopfschmerzen bereitet mir vielmehr die Prämisse, in der eine beobachtete Beziehungsunwilligkeit mit „Angst vor der Liebe“ gleichgesetzt wird. Denn tatsächlich habe ich noch nie jemanden über sich selbst sagen hören, er habe Angst vor der Liebe. Sehr geläufig ist mir allerdings die Klage, dass ein (potentieller) Partner Angst vor der Liebe / der Verantwortung / einer festen Beziehung habe. Eine fremdwahrnehmende Diagnose also, die von bindungswilligen Menschen über diejenigen geäußert wird, die sich – aus welchen Gründen auch immer – nicht so binden wollen wie sie sollten.
Natürlich ist der Gedanke, dass Angst dahinter steckt, recht einleuchtend. In der Pubertät jedenfalls. Allerdings überraschen mich junge Menschen gerade mit dem furchtlosen Gegenteil: ihrer unbeirrbaren Selbstsicherheit, die einzig wahre, ewige Liebe mit dem ersten Kuss ganz zweifellos und felsenfest erkannt zu haben. Ist das Urvertrauen? Mut? Naivität? Ich weiß es nicht.
Mit 40 jedenfalls hat die Zahl derer, die im Stadium der Verliebtheit voller Überzeugung „Alles jetzt und jetzt für immer!“ verkünden, deutlich abgenommen. Trotzdem fühlen sich Frühlingsgefühle natürlich noch immer so an: absolut, besitzergreifend, einzigartig, atemberaubend, perfekt, alles in den Schatten stellend und ultimativ. Zumindest für mich. An den Gefühlen haben also all die gelebten, gescheiterten, überwundenen, bewahrten oder transzendierten Beziehungen nichts geändert.
Hinzugekommen ist allerdings die ganz persönliche und ungemein lebensnahe Beziehungspraxis. Und mit ihr häufig auch die Feststellung, dass für Verliebtheit und Leidenschaft andere Spielregeln gelten als für tragfähige Langzeitbeziehungen. Andere Bedürfnisse, andere Anforderungen, andere Tabus, andere Königsdisziplinen, andere Intensitäten, andere Hormone, andere Vorlieben und Ideale. Natürlich mag es auch Paare geben, die auf allen Beziehungsebenen miteinander kompatibel sind, und sich noch als Greise heimlich und verführungsverheißend ins Ohrläppchen beißen, während sie eine glücklich und unbeschwert hopsende Enkelkinderschar umringt. Allerdings begegnen mir diese Paare ähnlich oft wie der Satz „Ich habe Angst vor der Liebe.“ Und so komme ich zu meinem Zweifel an einer weit verbreiteten Angst vor der Liebe zurück:
Ist es nicht auch möglich, dass Menschen, die sich gegen die Fortsetzung einer Beziehung entscheiden, dies gänzlich angstfrei und im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte tun? Dass sie sich vielleicht lieber auf ihre Freunde als auf ihre Liebespartner verlassen. Dass sie im Laufe ihres Lebens möglicherweise gelernt haben, über den Tellerrand hormoneller Begeisterung hinaus zu blicken? Dass sie sich selbst besser einschätzen können und einfach wissen, was ihnen wichtig ist, wenn die rosa Brille verloren gegangen ist? Kurz: Dass sie nicht irgendetwas vorschieben, um ihre Angst zu verstecken, sondern einfach sagen, was sie wirklich denken, und Entscheidungen treffen, die für ihr Leben und Seelenheil gut und sinnvoll sind?
Im Verlauf des Artikels werden „Sie lacht zu laut“ und „Er trägt komische Schuhe“ als Beispiele zwanghaft gesuchter Inkompatibilität und Ausdruck vermeintlicher Selbstsabotage ins Feld geführt. Ja, stimmt schon: das sind lächerliche Vorbehalte. Allerdings muss ich eingestehen, dass sich mein Bauchgefühl fast ausschließlich mit solch lächerlichen Kleinigkeiten beschäftigt. Trotzdem fahre ich gut damit, ihm zu trauen. Die einzige Beziehung, die ich bereue, habe ich tatsächlich dem Umstand zu verdanken, dass ich der Unke in meinem Hinterkopf Oberflächlichkeit vorwarf und mich auf die Beziehung einließ, obwohl er Jeans mit hohem Bund trug. Es dauerte etliche Monate unfruchtbarer und ermüdender Streitigkeiten, bis sich genug triftige Gründe angesammelt hatten, dass ich mir ein aktives Trennungsverhalten zugestand. So absurd es auch klingt: Rückblickend lassen sich alle Unstimmigkeiten mit dem erinnerten Bildausschnitt eines Gürtels in Bauchnabelhöhe zusammenfassen.
Worauf ich hinaus will: Verliebtheit und Leidenschaft sind meiner Meinung nach einfach keine Vorstadien der Liebe. Sie sind etwas Eigenes. Und Liebe mündet nicht automatisch in eine Familiengründung. Auch viele gemeinsame Jahre, Kinder, Häuser und Erfolge garantieren keinen gemeinsamen Lebensabend. Natürlich ist es schön, durch alle diese Stadien mit einem Menschen zu gehen. Aber es ist nicht selbstverständlich.
Diese Weltsicht ist vielleicht ernüchtert. Jedoch schmälert sie nicht meine Bereitschaft mich mit Haut und Haaren und allen Konsequenzen auf einen Menschen einzulassen. Ganz im Gegenteil. Es fällt mir leichter Menschen so zu lieben, wie sie sind, wenn ich nicht den Anspruch habe, jede Beziehung zur eierlegenden Wollmilchsau zu machen. Es fällt mir leichter das zu genießen, was ich gerade erlebe – gerade weil ich um die Endlichkeit dieser Gefühle weiß und ahne, dass für langfristige Pläne der Boden fehlt. Eine Verliebtheit ist doch nicht weniger wert, wenn sie als Ausnahmezustand himmlisch ist jedoch als alltägliches Lebenskonzept untragbar wäre. Eine Ehe ist nicht weniger wert, wenn kein Kinderwunsch sie krönt. Eine Familie ist nicht weniger wert, wenn sie als Patchwork fortbesteht. Und eine Lebensbündnis ist nicht weniger wert, wenn man nie verliebt ineinander war.
So gesehen ließe sich auch dem „Alles-oder-Nichts-Typ“ Angst vor der Liebe unterstellen. Weil er die Komplexität und Widersprüchlichkeit menschlicher Beziehungen einfach ignoriert, um sich hinter einem Ideal zu verschanzen, das alle Unterschiede nivelliert und Menschen auf eine Schnittmenge reduziert. Weil er nicht bereit ist das Wagnis einzugehen, eigene, krumme und improvisierte Wege zu suchen, wo Hollywood scheitert. Weil er nicht den Mut hat sich einzugestehen, dass jeder Mensch so viel mehr ist als ein Beziehungsideal vorsieht. Und auch über eine solche Angst ließe sich schreiben:
Man sucht sich jemanden, der auf einem anderen Kontinent wohnt, beziehungsunwillig, unverbindlich oder vergeben ist, Hauptsache unerreichbar. Und wenn dann die fein austarierte Nähe-Distanz-Linie überschritten wird –
ist er/sie weg.
Auch diese Angst – wenn es sie denn geben würde – wäre eine Angst vor dem Leben.