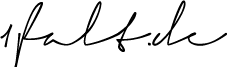Ausgelaugt.
Ein verspäteter Beitrag zu Lebensqualität und Digitalisierung:
Seit ein paar Jahren antworte ich auf die Frage, wie es mir geht, zumeist mit „eigentlich super, ich schlafe nur zu wenig“. In den letzten Monaten wurde das „nur zu wenig“ zum „nur nicht“ und das „eigentlich super“ zum „eigentlich ziemlich dreckig“. Der Zusammenbruch zum Fest kam also derart absehbar, unspektakulär und punktlandend, dass er kaum noch als solcher zu erkennen war. Das Projekt und ich, wir hatten fertig und dabei eben auch Federn lassen müssen. Von Burn Out zu sprechen erschien mir unangemessen; hätte dies doch impliziert für irgendetwas Feuer und Flamme gewesen zu sein und dann kein Maß gefunden zu haben. Die Metapher passte nicht. Ich war nicht ausgebrannt sondern ausgelaugt: zu oft gewaschen und geschleudert, brüchig, löchrig, fadenscheinig geworden, aus der Form geraten, irgendwie zu alt für alles. Keine Aussicht darauf, nach ein paar Tagen Rückzug und Kreativpause wie ein Phönix aus der Asche steigen zu können. Es musste sich etwas Grundlegendes ändern.
Trotzdem griff ich zu, als ich neben den EDV-Handbüchern (es heißt wirklich noch „EDV“ und es gibt tatsächlich noch Handbücher!) den Titel Digitaler Burnout las. Der Klappentext brachte mein Unbehagen und die kläglichen Versuche, den Ursprung meiner miesen Launen und Gereiztheiten zu entschuldigen, so ziemlich auf den Punkt:
Wir begeben uns in einen Zustand der immer kürzeren Sinneinheiten, der pausenlosen Unterbrechungen und des ständigen Abgelenktseins. Diese antrainierte Aufmerksamkeitsstörung treibt uns kurzfristig an die Grenzen unserer Belastbarkeit und langfristig weit darüber hinaus. Sie behindert damit aber nicht nur unsere Produktivität, sondern zerstört unser gesamtes Lebensglück.
Also verbannte ich gestern nachmittag meine Endgeräte (probeweise) aus dem Bett und las das Buch. Ich scannte, überblätterte und zitierte nicht, sondern las mich einfach nur so durch. Zu meiner Überraschung war das gar nicht so schwer wie ich befürchtet hatte. Es tat tatsächlich gut:
Auf der Grundlage einer großangelegten bonner(!) Menthal Balance-Studie, welche das Verhalten von 300 000 Smartphone-Nutzern untersucht hat, stellt Alexander Markowetz unter vielem Anderen fest, dass wir uns im Schnitt alle 18 Minuten vom Gerät unterbrechen und aus dem Konzept bringen lassen. Ein paar Seiten später steht, dass es 15 Minuten ungestörte Konzentration braucht, bis sich ein Flow-Zustand einstellen kann. Bleiben statistisch 3 Minuten Zeit für Produktivität – vorausgesetzt, man beherrscht derart minutengenaues Zeitmanagement und ist mit einem inneren Border Collie gesegnet. Für den eher mittelmäßig organisierten Single-Tasking-Durchschnitt wie mich, der längere Zeit konzentriert an einer Sache arbeiten muss, damit was Gescheites dabei rauskommt, beginnt die Prime-Time also erst, wenn das Handy verstummt und der Tunnelblick eine echte Chance bekommt. Und dann macht die Arbeit plötzlich auch wieder Spaß.
Bis gestern Abend bin ich ohne darüber nachzudenken davon ausgegangen, das Durchmachen sei die Hauptursache für meine Dauererschöpfung. Ist ja schließlich nicht bio, so ein Rhythmus. Trotzdem muss ich zugeben, dass sich diese ungestörten, fleißigen Nächte und auch die zufrieden, in Watte gepackten Vormittage danach wirklich gut angefühlt haben. Wenn es also stimmt, dass fokussiertes Tun eine Grundlage für mentale Gesundheit und Zufriedenheit ist, dann wäre das sogar ziemlich logisch. Dann hätten mir die durchgemachten Nächte und Wochenenden nicht nur die Existenz sondern auch den Verstand gerettet.
Es ist Sonntagmorgen, 17 Minuten nach 6. Seit Stunden kein Push, der Hund schnarcht. Es herrscht himmlischer Frieden.
Heute wird ein guter, analoger Tag.