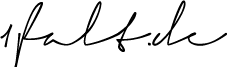Bipolar
Meine zwei großen Schwestern. Sie könnten unterschiedlicher nicht sein. Anna ist groß und weich, die Stimme ruhig und sanft, die Augen dunkel. Auf ihrem Gesicht liegt meist ein müdes, altes Lächeln. Konstanzia hingegen ist klein und drahtig. Alles an ihr ist auf Äußerste gespannt und wachsam. Sie hat Witz, ist klug, scharfzüngig und respektlos. Im Unterschied zu mir verfügen sie beide – jede auf ihre Art – über eine beachtliche Präsenz. Wenn sie einen Raum betreten, nehmen sie ihn in Besitz. Ganz. Man kann sie weder übersehen noch kommt man an ihnen vorbei. Ihre Energie zieht Menschen in den Bann oder stößt sie ab. In jedem Fall bleiben sie mit prägnanten Strichen im Gedächtnis.
Ich bin da eher farb- und konturlos. Leute wissen meist nicht, worüber sie mit mir reden könnten. Folglich fragen sie mich nach meinen Schwestern. Und ich bin erleichtert, die peinliche Stille überwinden zu können. Also erzähle ich von ihnen, richte Grüße aus, arrangiere Rendezvous und genieße die Aufmerksamkeit – so wenig sie mir auch gilt. Manchmal werde ich gefragt, ob ich nicht eifersüchtig wäre, mich zurückgesetzt und übersehen fühle. Denn übersehen werde ich tatsächlich oft. Mich irritiert diese Frage. Die Vorstellung, mit ihnen verglichen zu werden, erscheint mir recht absurd. Beneiden Sie Libellen um ihre Flügel oder Katzen um ihre Fangzähne? Tatsächlich bewundere ich sie – ja, das schon – aber wirklich neidisch bin ich nicht.
Es lässt sich viel Unvorteilhaftes über meine großen Schwestern sagen – aber sie lieben mich. Beide auf ihre Art, beide bedingungslos und aufrichtig. So wenig sie miteinander anfangen können, so interessiert sind sie an mir. Vielleicht bin ich für sie so etwas wie das Zünglein an der Waage ihrer Konkurrenz, die Ausschlag gebende dritte – wenn auch leise – Stimme. Und ich gebe zu, dass ich sie manchmal gegeneinander ausspiele. Sie nehmen es mir nicht übel, denn es gehört irgendwie dazu.
Wenn ich versuche, mir Situationen in Erinnerung zu rufen, in denen ich allein war, sehe ich mich irgendwo still sitzen und malen. Später ging ich spazieren, schrieb lange Briefe oder arbeitete im Garten. Doch wenn ich ganz genau hinsehe und jede Ecke einer solchen Erinnerungen durchkämme, finde ich meist doch eine von ihnen im Hintergrund über mich wachen. Sie lassen mich vielleicht nie aus den Augen. Auch nicht wenn ich schreibe. Obwohl sie fürchterlich langweilig, talentfrei und überflüssig finden, was ich so zu Papier bringe.
Unbemerkt wurde die Schreiberei zu einem Anker, der verhinderte, dass ich mich ganz von ihrem Einfluss vereinnahmen ließ. Als Text war ich endlich greifbar für mich selbst. Ich lernte mich mitzuteilen und lernte Menschen kennen. Menschen, die plötzlich mehr mit mir gemein hatten als mit meinen Schwestern. Es waren aufmerksame und vorsichtige Menschen. So fand ich Freunde. Wir genossen den Frieden und die Ruhe, wenn die Schwestern aus dem Haus waren. Das waren schöne, milde und freundliche Stunden. Und so wuchs in mir der Wunsch nach einem ganz eigenen, selbstbestimmten Leben.
Irgendwann nahm ich all meinen Mut zusammen und setzte meine beiden Schwestern vor die Tür. Erschreckt über meine eigene Courage kniff ich die Augen zusammen, hielt mir die Ohren zu und erwartete ein Unwetter. Doch der befürchtete Aufstand blieb aus, sie akzeptierten meine Entscheidung. Manchmal sah ich noch eine von ihnen auf der anderen Straßenseite, manchmal trafen wir uns im Park. Doch gab es immer weniger, was uns miteinander verband. Wir wurden uns fremd.
Viele gute Jahre später stolperte mein sorgsam getaktetes Leben, strauchelte und geriet aus der Bahn. Den Sturz überstand ich schadlos – doch dort, wo ich nun gelandet war, kam ich nicht zurecht. Das Klima war unbeständig, besonders die Schwüle machte mir zu schaffen. Ich hatte unbändigen Hunger, war erschöpft und wusste weder ein noch aus. Die Angst wuchs und türmte sich vor mir auf. Da kamen sie zurück und standen mir zur Seite. Dort, wo ich nun war, waren sie ganz in ihrem jeweiligen Element. Konstanzia lehrte mich das Jagen. An ihrer Seite wurde ich stärker, schneller und wendiger. Sie lachte über meine Furcht, stieß mich von den Klippen und hielt mich fest, wenn tosende Wellen über mir brachen. Nie hatte ich mich so lebendig gefühlt, nie war ich so wach gewesen. Erst wenn ich erschöpft zusammenbrach, ließ sie mich los. Dann fing Anna mich auf und barg mich in ihrem wiegenden Schoß. Müde, satt und schwer vergaß ich die Zeit, vergaß mich, vergaß das Leben. Die große dunkle Schwester strich mir summend über’s Haar, strich die Tränen fort und schüttelte lächelnd aber bestimmt den Kopf, wenn ich begann von meinen Pflichten zu reden.
Irgendwann siegte die Vernunft. Ich bestellte ein Taxi und ließ mich in ein Krankenhaus fahren. Dort lernte ich Maria kennen. Nach ein paar Tagen stellte mir Maria ihre Depression mit den Worten vor: „Das ist Klaus Rüdiger. Klaus Rüdiger ist ein Arschloch.“ Ich wusste nicht, was ich dazu hätte sagen können. Doch in Gedanken schrieb ich diese eine Zeile: „Das sind Anna und Konstanzia. Sie sind alles, was ich habe.“
Foto: Neil Moralee