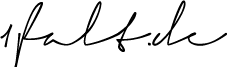Digitale Dorfkultur
Martin ist Journalist und Blogger. Er schreibt vor allem darüber, wie das Digitale die Gesellschaft verändert. Gelegentlich schreibt er auch darüber, wie das Digitale ihn selbst bzw. sein eigenes Schreiben verändert, und betitelt seine Überlegungen mit Warum ich als Journalist nur noch die Monster füttere. Diese Überlegungen lesen sich ein wenig nach Burn-Out und resigniertem Leergeschriebensein. Seine Sicht ist sehr klar, reflektiert und bringt auf den Punkt, was sonst nur als diffuses Mimimi durch die Selbstreferenz der Netzgemeinde wabert.
Ich selbst bin weder Journalist noch Blogger. Ich schreibe lediglich Texte auf Bestellung oder aus Befindlichkeit. Es sind Texte, die geschrieben werden wollen. Entweder weil ein Kunde sie in Auftrag gegeben hat oder weil mich ein Thema so sehr umtreibt, dass ich es ordnen, verstehen und loswerden will. Wenn die Texte fertiggeschrieben sind, bin ich zumeist zufrieden mit mir. Und zwar unabhängig von Resonanz und Reichweite. Wenn ich sie nachträglich doof, falsch oder missverständlich finde, werfe ich sie weg.
Schreiben ist eine Form des Aufräumens für mich. Ich habe selten Spaß dabei, aber ich liebe es, in einem aufgeräumten Zimmer, zwischen frisch geharkten Beeten, an einem entrümpelten Schreibtisch oder unter einem klaren Gedanken zu sitzen. Metaphorisch füttere ich also keine nimmersatten Monster, sondern bringe Sperrmüll runter. Anschließend stehe ich auch nicht am Fenster und warte darauf, dass sich Menschentrauben vor meinem Haus bilden. Aber natürlich freue ich mich, wenn irgendwo Verwendung findet, was bei mir keinen rechten Platz hatte.
Mein Netzkonsum gleicht dem Schlendern über einen Trödelmarkt. Ich bin kein Morgenmensch, darum ist der wirklich heiße Scheiß längst vertickt, wenn ich aufwache. Also erwartet mich hauptsächlich Tüddelkram und Kitsch, ein paar versteckte Perlen und eine Hand voll Leute, die mir mit der Zeit ans Herz gewachsen sind, deren Stände ich regelmäßig besuche – sei es auch nur um einen Plausch zu halten und ein paar alte Ladenhüter abzustauben.
Martin schreibt, dass Twitter-Deutschland ein Dorf ist. Ich gebe ihm recht. Zum Glück! Denn auf dem Dorf wird man wahrgenommen. Sicher kann nicht jeder Gemeindevorstand oder Maikönigin werden – aber wer will seine Freizeit schon auf Schützenfesten, Gewerbeschauen und im Junggesellenverein verbringen?
Ich lebe und arbeite gern auf diesem Dorf im Internet. Das Zusammenleben gestaltet sich freundlich bis freundschaftlich, und es hat sich rumgesprochen, dass ich meine Arbeit gut mache. Das sorgt für ein stabiles soziales Umfeld und sichert mir mein Auskommen. Es gibt Menschen, die mich mögen, die mir von sich erzählen und sich dafür interessieren, was mich umtreibt. Es gibt Freunde, mit denen ich streiten und von denen ich lernen kann. Es gibt Nachbarn, die sich mit Obstbaumschnitt, Waschmaschinen, Linux und Soufflés auskennen, die mir Geräte leihen und Weihnachtsplätzchen backen. Die Wege sind kurz in diesem Dorf und alle Dinge des täglichen Lebens unmittelbar erreichbar. Wenn ich mich ein paar Tage nicht blicken lasse, kommt jemand vorbei und sieht nach dem Rechten. Manche helfen ungefragt, wenn sie bei mir Sperrmüll rumstehen sehen, den ich allein nicht bewegt bekomme. Das macht mich froh und dankbar.
Ich träume nicht davon bei Deutschland sucht den Superblogger entdeckt zu werden. Vielleicht liegt das daran, dass ich mich in meinem virtuellen Radius tatsächlich wertschätzend gesehen fühle. Und für einen Moment scheint es mir, als sei genau das ein Bedürfnis, das sich nicht oder nur schwer mit anonymen Followerzahlen und Highscores kompensieren lässt. Vielleicht tröste ich mich aber auch nur darüber hinweg, dass sich die wirklichen Metropolen nicht für Landeier wie mich interessieren.
Foto: Adrian Ulrich