
Lieber tot
Ich habe noch nie ein Buch über Depressionen gelesen. Zumindest nicht zu Ende. Angesichts der Tatsache, dass ich zu fast jeder Nebensächlichkeit meines Lebens ein Buch gelesen (oder zumindest gekauft) habe, ist das geradezu komisch. Ich kann also guten Gewissens sagen, dass ich keine Ahnung von Depressionen habe. Dafür gibt es auch einen Grund: Mich stört das Weltschmerz-Image. Weinerlich und voller Selbstmitleid. Bah! Mag schon sein, dass ich das manchmal bin. Trotzdem finde ich es unerträglich, damit konfrontiert zu werden. Vor allem, wenn es mir schlecht geht.
Woran mache ich fest, dass es mich schlecht geht? Daran, dass ich lieber tot wäre. Sehr schlecht geht es mir, wenn ich sehr viel lieber tot wäre. Dass ich mich damit einverstanden erklärt habe, diesen Zustand „Depression“ zu nennen, liegt an der Tatsache, dass er sich nahezu unabhängig von meiner objektiven Lebensqualität einstellt. Ich werde depressiv, obwohl alles super läuft … oder weil alles super läuft … oder damit endlich nichts mehr so unerträglich super läuft. Mittlerweile bin ich mir jedenfalls sicher: Es gibt da keinen Zusammenhang. Das ist einerseits schrecklich (Glück macht es ja nicht besser) und andererseits tröstlich (Pech macht es wenigstens nicht schlimmer).
In etwas älteren Romanen werden die mir ähnlichen Frauenzimmer oft als „überspannt“ beschrieben. Ich mag das Wort. Nerven wie ein überspanntes Gummiband – das kann ich mir super vorstellen und es nachempfinden! Beim geringsten Anlass macht es *flitsch* und das heulende Elend bricht sich Bahn. Außerdem gefällt mir, dass diese überspannten Damen in ihrer Dramatik nie so ganz ernst genommen werden. So geht es mir ja mit mir selbst auch, wenn ich lieber tot wäre: Ich kann das nicht wirklich ernst nehmen. Auch wenn es manchmal ernst ist. Den Galgenhumor will ich mir jedenfalls nicht austreiben lassen. Auch nicht, wenn niemand mehr lacht. Und erst recht nicht mittels Anteilnahme und Zuwendung!
Hier liegt übrigens der Hund begraben, wegen dem ich keine Bücher über Depressionen lese: Ich befürchte, dass sie alle schrecklich verständnisvoll sind. Und einfühlsam. Und aufbauend. Und mutmachend. Das sind natürlich Vorurteile, denn ich habe ja keine Ahnung, was in Büchern über Depressionen steht. Also lasse ich die Hypothesen und schreibe nun über mein Leben. Genauer gesagt über das, was mir gut tut, wenn ich lieber tot wäre. Leider finde ich dann genau das ausgesprochen sinnlos, albern und viel zu anstrengend. Es zieht mich schließlich ins Leben zurück. Und das will ich ja gerade nicht. Ums Verrecken nicht, sozusagen. Trotzdem tut es mir gut. Und wenn Sie jetzt denken „Ah, die ist ja gar nicht depressiv, die ist nur sehr wütend“, könnten Sie ein klein bisschen recht haben. Leider ist diese Wut ausgesprochen – na sagen wir mal: destruktiv. Also macht es die kluge Einsicht nicht wirklich einfacher für uns.
Trotzdem ist sie durchaus nützlich, um in Betracht zu ziehen, dass die lethargische Person in ihrem ungelüfteten Zimmer (evtl. ich) ganz plötzlich und unerwartet faucht und kratzt. Verbal natürlich, aber nicht weniger schmerzhaft. Und wenn sie das tut, sag ich jetzt mal (als derzeit Außenstehende): Bravo! Sie haben alles richtig gemacht! (Zumindest wenn ich diese Person bin.) Denn in einem bin ich mir sicher: Niemand kann einen akut depressiven Menschen glücklich machen. Leider. Es wird nur schlimmer, wenn so ein Trauerklops sieht, was da alles für ihn getan, gelitten und zurückgesteckt wird. Dann setzt sich auf den Klotz in der Brust noch ein ordentlicher Brocken schlechtes Gewissen. Der lässt sich natürlich noch toppen: „Du musst doch kein schlechtes Gewissen haben, das ist eine Krankheit, Du kannst ja nichts dafür!“ *Zack!*, schon sitzt ein Märtyrer auf dem Brocken auf dem Klotz in der Brust. Das Ergebnis ist Selbsthass. Und der ist auch nicht gerade – vital.
Wo war ich stehen geblieben? Ach ja: „Niemand kann einen depressiven Menschen glücklich machen.“ Stimmt. Aber wütend! Das wollte ich schreiben. Ja ich weiß, ich werde mich irgendwann selbst dafür verfluchen, diese Möglichkeit ausgeplaudert zu haben, aber es dient ja einem guten Zweck. Also: Auch wenn es nicht so aussieht, bin ich durchaus empfänglich für Provokation. Auch wenn ich depressiv bin und nur meine ewige Ruhe will. Allerdings sollten Sie Zeit mitbringen, wenn Sie das mal ausprobieren möchten. Denn wenn es Ihnen gelingt, sich mit mir anzulegen, dürfen Sie die nächsten paar Stunden nicht weg. Erst beißen, dann weinen, dann lauter weinen, hysterisch weinen, müde weinen, einschlafen. Das kann dauern und ist anstrengend. Doch danach geht es bergauf. Versprochen. Natürlich kann und darf sowas nicht zur Regel werden. Am besten sollte es natürlich gar nicht erst so weit kommen. Schließlich gibt es ja wirklich viele medizinische und therapeutische Möglichkeiten „prophylaktisch“ tätig zu werden. Und wenn es doch mal daneben geht, bieten sich gut ausgestattete Ambulanzen und Akutstationen mit mächtigen Drogen an. Es gibt also durchaus „Menschen, die sich mit sowas auskennen“.
Meiner Erfahrung nach sind genau die aber nicht da, wenn es mir echt schlecht geht. Da sind dann die „Menschen, die sowas wie mich lieben“. Laien mit Herzblut sozusagen. Darum möchte ich, dass auch die sich damit auskennen. Damit sie sich nicht überfordert fühlen. Damit sie meinen Zustand nicht persönlich nehmen. Damit sie es sich selbst und auch mir nicht schwerer machen als es sowieso schon ist.
Können Sie sich noch an die Sümpfe der Traurigkeit in der Verfilmung der „Unendlichen Geschichte“ erinnern? Die Szenerie passt recht gut zu meiner Innensicht an finsteren Tagen. In so einer Landschaft ist niemandem geholfen, wenn irgendwann alle mitfühlend in meinem Sumpf feststecken und sich gegenseitig runterziehen. Viel besser also: Gelassen auf festem, trockenem Grund stehen bleiben, unerschrocken Äste zuwerfen (auch auf die Gefahr hin, dass mal einer an meinem Kopf landet), ein paar Witze machen und jemanden anrufen, der sich mit sowas auskennt. Einen Sicherheitsabstand zu wahren ist vielleicht nicht nett aber durchaus hilfreich. Also bei mir. Ich kann da wie gesagt nur von mir sprechen. Aber so unterschiedlich sind die Menschen dann möglicherweise doch wieder nicht. Vielleicht fragen Sie an guten Tagen ganz prophylaktisch mal nach, wie das denn so wäre … also nur so theoretisch … so im Fall der Fälle. Und wenn Sie dann gemeinsam feststellen, dass doch Wärmflasche, Kekse und Tocotronic das Mittel der Wahl und Streiten doof ist: Prima! Schön, dass Sie mal drüber gesprochen haben, oder?
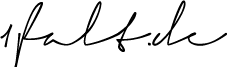
Lieber Neffe 1falt,
interessanter Artikel – sag mir mal Bescheid, wenn Du Dich schlecht fühlst, dann werde ich versuchen, Dir auf wütend machende Weise zu sagen, dass Du Bücher über Depressionen lesen sollst.
In der Taz-Online war neulich eine ganz gute Glosse zum Thema.
http://www.taz.de/Kolumne-Bestellen-und-Versenden/!129261/
Ansonsten finde ich interessant, wie unterschiedlich depressive Zustände bei unterschiedlichen Menschen sind.
bis hoffentlich bald
Lieber Onkel Maike,
den taz-Artikel finde ich auch sehr spannend! Vor allem in Verbindung mit den Leser-Kommentaren. Die spiegeln so ein bisschen meinen Eindruck, dass Empathie als die einzig angemessene Reaktion im Umgang mit dem Thema Depression angesehen wird. Jede andere Umgehensweise setzt sich sofort dem Vorwurf aus, herzlos und verharmlosend zu sein. Natürlich sind Depressionen mit einem hohen Leidensdruck verbunden. Das gilt aber auch für die Angehörigen. Es scheint ein Tabu zu berühren, dass Angehörige von depressiven Menschen massiv unter den Folgen dieser Krankheit leiden. Das scheint mir vielfach ausgeblendet.
Bei Suchterkrankungen ist der Begriff der Co-Abhängigkeit mittlerweile etabliert und selbstverständlich geworden. Niemand wird bestreiten, dass Alkoholismus ganze Familien aus dem Gleichgewicht bringt und sie „in Beschlag nimmt“. Jedem ist auch irgendwie klar, dass es Distanz braucht, um wirklich Hilfestellung leisten zu können. Systemisch betrachtet liegen pathologische Depressionen und Suchterkrankungen meiner Meinung nach gar nicht so weit auseinander. Außerdem macht der Umgang mit Suchterkrankungen deutlich, dass eine pragmatische, handlungsorientierte Herangehensweise nicht automatisch gleichbedeutend mit Verharmlosung ist. In der öffentlichen Wahrnehmung werden beide Krankheitsbilder aber völlig anders gehandelt. Da wird Depression eher mit Trauer in einen Topf geworfen. Und Trauer braucht Empathie, Beistand, Trost, Rücksichtnahme. Trauer ist eine sinnvolle Emotion, ein konstruktives Verarbeiten konkreter Verletzungen, ein Heilungsprozess. Depressionen sind all das nicht. Die Zeit heilt keine Depressionen. Die Zeit bewirkt eher das Gegenteil. Sie verstärkt und verfestigt Mechanismen, die Depressionen begünstigen. Negative Gedanken schleifen sich ein und bilden Teufelskreise aus. Rücksichtnahme, Verantwortungsübernahme, Aufopferung und Kompensation durch das Umfeld machen depressive Menschen langfristig zu einer nutzlosen Belastung. Zumindest für mich ist das absolut kontraproduktiv. Es tut mir nicht gut. Noch nicht einmal wenn es ehrlich ist und von Herzen kommt. Und irgendwann ist es auch nicht mehr ehrlich. Irgendwann wächst jedem, der hilflos daneben steht, die Situation über den Kopf. Überforderung, Aggression, Verzweiflung, Ohnmacht, Abstumpfung, und auch Selbstmitleid sind die Folge. Gefühle, die im Umgang mit depressiven Menschen leider als „unangemessen“ markiert sind. Da ist nur grenzenloses Verständnis erlaubt. Ich habe oft gehört, der Betroffene leide ja schließlich schon genug an sich lebst, bzw. seiner Krankheit. Doch was bleibt dem ohnehin depressiven Gemüt da noch anderes übrig, als sich zumindest so nützlich zu machen, indem es all diese negativen Gefühle stellvertretend übernimmt? Und dabei immer mehr Selbstbewusstsein und Handlungsfähigkeit verliert.
Wie gesagt: Ich habe keine empirische oder theoretische Ahnung von Depressionen. Ich kenne nur die Kreisläufe und Symptomatiken in meinem eigenen Lebensumfeld. Die aber aus recht vielen Perspektiven. Es ist mir wichtig zu wiederholen, dass ich nur über das schreibe, was ich selbst erlebe und wahrnehme. Ich bin mir durchaus bewusst, dass Menschen, die in erster Linie Trost und Einfühlung brauchen, nicht zu mir kommen. Da ist bei mir eben nicht viel zu holen, darin bin ich sehr schlecht. Ich gebe mir große Mühe das zu lernen, aber noch bin ich bestenfalls hölzern. Das hat natürlich Einfluss auf meinen Blickwinkel. Ich lerne eben Menschen kennen, die von dem profitieren, was ich bin und kann. Ich weiß nicht, was „Depressionen“ wirklich sind. Ob dieses Wort Substanz hat. Eigentlich will ich es auch gar nicht wissen. Wenn jemand über sich sagt, dass er depressiv ist, nehme ich das als gesetzt. Dann ist das so. Es steht mir nicht an, Selbstzeugnisse zu hinterfragen, und ich sehe auch keinen Sinn darin. Über mich selbst sage ich lieber, dass ich Stimmungen habe. Nicht um die Sache zu verharmlosen, sondern weil ich dann eher so behandelt werde, wie ich behandelt werden möchte. Der Schritt mich mit dem klinischen Begriff zu arrangieren, war also eher darin begründet, dass ich meinem Umfeld die Chance geben wollte, sich zu positionieren, Grenzen zu ziehen und selbst Hilfe in Anspruch zu nehmen, wenn das nötig ist.
… hab noch was vergessen!
In den taz-Kommentaren steht ein paar Mal (unterschiedlich formuliert), dass „melancholische Verstimmungen“ als Depressionen diagnostiziert werden und damit „echte“ Depressionen h e r a b s e t z e n.
Ich finde diese sprachliche Hierarchie des Leidens unglaublich bezeichnend und fatal. Es geht mir an keiner Stelle um eine Bemessung oder gar Bewertung des Leidensdrucks. Die Diagnose „depressiv“ ist ja kein Orden für Tiefsinnigkeit, den man sich an die Brust heften kann und fortan von allen Verpflichtungen des Lebens entbunden ist.
Und was wäre überhaupt so schlimm daran, wenn Leute ihre Verstimmtheiten Depressionen nennen? Dass sie möglicherweise Antidepressiva verschrieben bekommen? Ja, das ist durchaus möglich. Allerdings helfen die ja (leider) nicht gegen schlechte Laune. Also wage ich mal zu bezweifeln, dass die zumeist erheblichen Nebenwirkungen von Psychopharmaka in Kauf genommen werden, wenn es auch anders geht. Und so warten die vermeintlichen „Glückspillen“ (wenn sie fälschlicherweise gegen Übellaunigkeit verschieben wurden) lediglich ungeschluckt auf ihr Verfallsdatum. Sie bleiben eine Enttäuschung, denn sie machen nicht glücklich.
Umgekehrt finde ich die Ausweitung den Begriffs „Depression“ viel besorgniserregender. Wenn nämlich handfeste, konkrete Probleme und Missstände als Depressionen v e r h a r m l o s t werden. Wenn sich Menschen lieber krankschreiben lassen als sich gegen unzumutbare Arbeitsbedingungen und ebenso unmenschliche Arbeitslosigkeit zu wehren, wenn sie sich lieber in Kliniken flüchten als sich aus gewalttätigen Beziehungen zu befreien, wenn gesellschaftliche Missstände pathologisiert und zum persönlichen Defekt von Individuen gemacht werden … DAS finde ich schlimm.