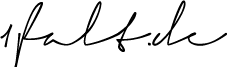Schere im Kopf
Foto: wwwuppertal.
Dort, wo ich aufgewachsen bin, ging es recht gläubig zu. Und natürlich glaubte auch ich mir meinen Teil. Das hätte sich wohl kaum verhindern lassen. Erst später gesellte sich der Reflex hinzu, genau hinzusehen. So genau, dass es manchmal als unhöflich empfunden wird. Zu meiner Verteidigung möchte ich deshalb vorbringen, dass dieser Blick meist freundlich gestimmt und wirklich interessiert an dem ist, was er da in Augenschein nimmt.
Je länger ich also hinsah und all die persönlichen Bekenntnisse, Stoßgebete und Predigten miteinander verglich, desto kleiner wurde die Schnittmenge dessen, woran sie alle glaubten. Desto kleiner wurde Gott. Bis er schließlich ganz verschwand. Was aber Bestand hatte und die Gemeinschaft weiter zuverlässig zusammenhielt, war die Form: der Ritus und die heiliggesprochene Schrift. Darin fanden sie alle Platz und ein Gefühl von Verbundenheit. Auch wenn sie in dem, was sie über ihren eigenen Glauben sagten – also über das, was ihnen wirklich wichtig war und am Herzen lag – kaum Berührungspunkte miteinander hatten.
Das passte lange nicht in mein von der Romantik gezeichnetes Selbstbild, das Subjektivität über alles stellte und für jedes Gefühl einen authentischen Ausdruck suchte. Meine Geringschätzung gegenüber vermeintlich leeren Floskeln, Formeln und Traditionen saß zu tief, um mich ihrer zu bedienen. Es gab nur schwarz oder weiß. Und allzu oft das Gefühl keine Wahl zu haben. Denn da gab ich Adorno recht – universell auch ohne den historischen Kontext dieses Satzes:
„Es gibt kein richtiges Leben im falschen.“
Die ersten Zweifel kamen mit einer grundlosen Umarmung. Plötzlich entstand Nähe, für die mein Kopf keine Entsprechung, keine Worte und keine Beziehung fand. Trotzdem fühlte sie sich echt an. Wie eine lange verdrängte Erinnerung. Ich bewertete es als Ausnahme, als Stimmung, als kuriosen Zufall. Doch immer öfter machte nun meine eigene Form – mein Körper – all dem, was ich über die Welt und mich zu denken gewohnt war, einen Strich durch die Rechnung. Er widersetzte sich, überrumpelte mich, wurde laut und fordernd, streikte – kurz: Er zeigte mit jeder Faser, dass er ein Eigenleben besaß.
Und je länger ich hinsah und all die persönlichen Bekenntnisse, Stoßgebete und Predigten miteinander verglich, desto kleiner wurde die Schnittmenge dessen, worin sich Geist und Körper noch einig waren. Desto kleiner wurde ich. Bis ich schließlich ganz verschwand. Was aber Bestand hatte und mein Leben weiter zuverlässig zusammenhielt, war die Form: die Gewohnheit, die lebendig gesprochene Sprache. Darin fand ich Platz und ein Gefühl von Verbindlichkeit. Auch wenn ich in dem, was ich über mich dachte – also in dem, was mir wirklich wichtig war und am Herzen lag – kaum noch Berührungspunkte mit mir hatte. Heute wage ich zu glauben:
„Es gibt ein Leben ohne Richtig und Falsch.“