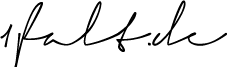So oder so
Wieder bin ich einen CSD älter, wieder hab ich mehr gesehen und aufgeschnappt als sich angemessen verarbeiten lässt. Mein Lieblingssatz fiel Samstagabend am Nachbartisch:
Aids ist um 22 Uhr, aber man kann was dagegen tun.
Mein erstes öffentliches Schaulaufen auf einer schwullesbische Großveranstaltung war 1996. Schon damals wurden HIV und der unpolitische Hedonismus der Gay Pride beklagt: zu laut, zu schrill, zu extravagant und exhibitionistisch. Eine Tradition, die sich wacker gehalten hat. Obwohl heute ausgesprochen wenig bloße Haut zu sehen war – trotz rekordverdächtiger Temperaturen. Der Trend scheint sich vielmehr in umgekehrter Richtung zu bewegen: Die Roben und Kostümierungen der Grand Dames werden von Jahr zu Jahr ausladender und pompöser. Besonders bei Schuhwerk und Kopfschmuck wurde heute wieder Beeindruckendes geleistet und Gewichtiges mit tapferem Lächeln ins Ziel getragen. Die unzähligen (semi-)professionellen Fotografen teilten meine Bewunderung und konkurrierten untereinander mit schwerem Gerät. Es war also wieder einmal ein rauschendes Fest der hohen Absätze, langen Wimpern und großen Objektive.
Und natürlich war er auch wieder politisch, der CSD. Zumindest waren alle renommierten Parteien vertreten und gemeinsam mit der Bildzeitung, führenden Apotheken, Versicherungen und Telefongesellschaften „dafür“. Oder zumindest „dagegen“ Also gegen Nazis. Fast könnte man den Rechten dankbar sein für diese abenteuerliche Schnapsidee den CSD zu kapern. Denn so fand sich endlich mal wieder ein gemeinsamer politischer Nenner und Anlass zum Schulterschluss: Wir sind – so oder so – contra Pro!
Allerdings frage ich mich mittlerweile, ob ein „Kampf für gleiche Rechte“ als politisch formulierte Forderung hier und heute überhaupt noch glaubwürdig ist. Sicherlich gibt es weiterhin und ungebrochen sexuelle Diskriminierung. Und in vielen Lebensbereichen werden normierte und arrogante Vorstellungen geschlechtstypischer Verhaltensmuster und Körperformen mit größerer Rücksichtslosigkeit und Härte durchgesetzt als noch vor ein paar Jahren. Aber lässt sich soziale Ungleichheit in Köln tatsächlich noch am Paarungsverhalten der Bevölkerung festmachen? Oder sind nicht vielmehr Mietspiegel, Qualifikationsniveau und Erwerbsbeteiligung die maßgeblichen Indikatoren für Privilegien und Ausgrenzung geworden?
Denn eines lässt sich mit Gewissheit sagen: Ein Wagen auf der Cologne-Pride ist kein Anzeichen für Benachteiligung sondern ein einträgliches Statussymbol, das sich nur wenige Non-Profit-Organisationen finanziell leisten können.
Also sehe ich mich wieder mit der leicht vorwurfsvollen Frage von ’96 nach der politischen Relevanz des Spektakels konfrontiert. Und ich finde beim besten Willen keine gescheite Antwort. Da meine eigene sexuelle Identität – und somit meine Daseinsberechtigung auf dem CSD – in den letzten Jahren ohnehin ins Bröckeln geraten ist, kann ich mich auch nicht wirklich weit aus dem Fenster lehnen. Allerdings habe ich heute feststellen können, dass ich nicht die Einzige mit Migrations-Hintergrund bin.
Natürlich passt das alles irgendwie zu „Wir sind – so oder so“ und es ist auch ok so. Weil sich das Leben eben einfach nicht in Schubladen stecken lässt. Noch nicht mal in die, die wir selbst für uns geschreinert und eingerichtet haben. Trotzdem erscheint es mir fatal einfach so zu tun, als wäre alles so wie früher. Denn das ist es nicht. Wir sind ja nicht unsichtbar geworden, nur unausgesprochen und missverständlich. Und das tut der Glaubwürdigkeit des CSD nicht gut. Befürchte ich.
Foto: Corinna Klingler