
Der Wald und die Bäume
Foto: Manuel Calavera.
Der Roman „Briefe in die chinesische Vergangenheit“ von Herbert Rosendorfer wurde in den 80ern geschrieben. Er erzählt die Geschichte eines chinesischen Mandarin aus dem 10. Jahrhundert, der versehentlich via Zeitmaschine im bayerischen München der Gegenwart landet: Genauer gesagt in Min-chen mitten in Ba-Yan, wo die Langnasen über Schei-we-ta klagen und Wan-tswa-xu-fa singen.
Als mir die Idee kam, einen Blogbeitrag darüber zu schreiben, wo vermutlich meine Probleme lägen, wäre meine Identität eine männliche, musste ich unweigerlich an dieses Buch denken. Denn vom alltäglichen Erleben eines Mannes verstehe ich ähnlich wenig wie der alte Chinese vom Straßenverkehr einer modernen Großstadt. Was soll das also bringen?
Aufmerksamkeit.
Denn eine Schwierigkeit (meine Schwierigkeit) beim Lesen aktueller Auseinandersetzungen, Einlassungen und Beschäftigungen mit dem Thema „Geschlechterdifferenz“ ist die kämpferische Grundstimmung. Ich lese Debatten, die vielfach erbittert geführt und verbittert abgebrochen werden. Die Fragen sind rhetorischer Natur, die Fronten sind verhärtet. Es sind politische Diskussionen, denn politische Ziele werden verfolgt, politische Umstände beklagt und politische Forderungen gestellt. Darum sollte es eigentlich sachlich zugehen. Das klappt aber nicht. Wie auch? Wenn die Motivation der DiskursteilnehmerInnen überwiegend (oder ausschließlich) emotionaler Natur ist, wird es nahezu unmöglich, eine nüchterne Gesprächshaltung einzunehmen. Also wird die sachliche Diskussionskultur lediglich vorgetäuscht. Unterschwellig geht die Post ab. Da schaukeln sich Emotionen gegenseitig hoch. Spätestens in den Kommentarspalten bröckeln dann die Fassaden. Der Subtext wird offen lesbar. Argumente weichen Beleidigungen und werden von Beschimpfungen abgelöst. Die sind dann oftmals so empfindlich unter der Gürtellinie und so weit von der Sachebene der Diskussion entfernt, dass mich ihre Absurdität zum Lachen brächte, wären die anfeuernden Verletzungen dahinter nicht so erschreckend. Irgendwann werfen sich die Parteien also gegenseitig vor, hässlich, hasszerfressen, verklemmt und sexuell frustriert zu sein. Wen wundert es da noch, dass die „sachlich geführte“ Debatte an der Oberfläche keine konstruktiven Ergebnisse liefert und keinen Konsens herbeizuführen vermag? Wen wundert es da noch, dass sich die „Gewinner nach Beifallspunkten“ in erster Linie durch Zynismus und Dickfelligkeit auszeichnen?
Ich erinnere mich, dass Schulhofstreitereien zu meiner Grundschulzeit manchmal mit vertauschten Positionen „nachgespielt“ werden sollen. Wirklich gut geklappt hat das eigentlich nie. Meist kam nicht mehr als ein überfordertes Schweigen mit vertauschen Rollen dabei rum. Das wurde dann so oder so ähnlich abgebrochen: „Mir fällt nix ein … SIE/ER HAT ABER…“. Trotzdem änderte sich irgendwie irgendwas. Also probiere ich es jetzt mal damit. Und wie früher fällt mir nicht viel ein. Aber das Bisschen, das mir in den Sinn kommt, schreibe ich hier auf, in der Hoffnung, dass es irgendwie irgendwas ändert. Nicht an der Diskussion an sich (so größenwahnsinnig bin ich nicht), aber vielleicht an meiner eigenen Sicht auf die Problematik. Oder an der Sicht der LeserInnen auf meine Position.
Wäre ich ein Mann, wäre ich froh über die gute Trainierbarkeit meiner Körperkraft und die bessere Durchblutung meiner Hände und Füße. Eine Glatze würde ich dafür allerdings nicht in Kauf nehmen wollen. Natürlich wären meine Schultern hocherfreut, von BH-Trägern befreit zu werden! Ob ich im Gegenzug dazu bereit wäre, Haare auf ihnen sprießen zu lassen? Ich bin mir nicht sicher, denke aber schon. Das wäre es mir wert.
Es käme mir auch sehr entgegen, seltener mit der Erwartungshaltung konfrontiert zu werden, Gespräche in Gang bringen und am Laufen zu halten zu können. Mein smalltalkunwilliges Ich träumt nicht gerade selten davon, ein Mann sein zu dürfen. Gemeinsames Schweigen – nicht romantisch verklärt, sondern einfach so – auf Parties, beim Essen, in Kneipen, beim Sport, in Auto, Bus und Bahn … völlig ohne mich dafür verantwortlich zu fühlen, wenn irgendwer Unwohlsein signalisiert. Überhaupt! Mich grundsätzlich nicht dafür verantwortlich zu fühlen, wenn sich irgendwer unwohl fühlt! Ja, das fände ich in der Tat ausgesprochen fabelhaft.
Was mir allerdings gewaltige Schwierigkeiten bereiten und wahrscheinlich alle anderen Vorteile für mich aufwiegen würde, wäre die Unterstellung, dass Zuneigung und Interesse bei mir grundsätzlich sexuell motiviert oder zumindest konnotiert sind. Und selbst wenn es gar keine Unterstellung wäre und meiner gefühlten Motivation tatsächlich entsprechen würde (was ich mir nicht vorstellen kann), käme ich wohl kaum damit zurecht. Und wenn ich mir dann auch noch vorstelle, in einer monogamen Partnerschaft zu leben, frage ich mich wirklich, wie sich das aushalten lässt. Denn wenn jede Form emotionaler Nähe und Zuwendung sexuell gelesen wird, bedeutet Monogamie nicht nur sexuelle Exklusivität sondern auch emotionale. Dann gäbe es nur eine einzige Beziehung, in der Zärtlichkeit und Nähe „erlaubt“ und „selbstverständlich“ sind. Jedem anderen Menschen gegenüber müsste ich peinlichst aufpassen, nicht missverstanden zu werden, nicht den Eindruck zu erwecken, ich wolle fremdgehen, wäre übergriffig, homo- oder pädosexuell. Meine Möglichkeiten der sozialen Interaktion würden somit auf ein Minimum zusammenschrumpfen und mich emotional recht bald verkümmern lassen. Zumindest, wenn ich das mit der Monogamie ernst nehme und das auch durchhalte, wenn sich meine Partnerin* irgendwann nicht mehr um mich „kümmern“ kann. Aus schlichter emotionaler Überforderung, weil die Bedürftigkeit einer ganzen Familie in ihre „Zuständigkeit“ fällt. Wenn sie dann auch noch in einem „sozialen Beruf“ arbeitet oder als Dienstleisterin „nett“ zu sein hat, bleibt einfach nicht viel Herzlichkeit für den Gatten übrig.
Wenn ich mir ein Leben in einer solch traditionellen Männerrolle vorstelle – mit allen Konsequenzen – werden viele „männliche Verhaltensweisen“ für mich nachvollziehbarer. Das ändert nichts daran, dass ich ich es untragbar finde, Sexualität zu einer käuflichen Dienstleistung zu machen. Es ändert nichts daran, dass ich es unannehmbar finde, Menschen zu hintergehen, die mir vertrauen. Es ändert nichts daran, dass Sex ohne die Freiwilligkeit aller Beteiligten für mich völlig inakzeptabel ist. Es lässt mich aber daran zweifeln, ob es unter den derzeitigen strukturellen Bedingungen unseres Zusammenlebens überhaupt möglich ist, ein Mann zu sein, der den berechtigten Ansprüchen emanzipierter Frauen gerecht wird.
Irgendwo habe ich gelesen, für Frauen sei es ja leichter Sexualpartner zu finden (darum müsse dieser Frauenvorteil durch Prostitution ausgeglichen werden). Dies ist (aus meiner, nun wohl wieder weiblichen) Sicht ein unzulässiger Zirkelschluss, da ein solcher „Vorteil“ lediglich dadurch entsteht, dass Frauen einfach kein Interesse an dem haben, was sie „leichter“ haben könnten, und somit freiwillig verzichten. Warum? Weil ihr Sexualtrieb weniger stark ausgeprägt ist?
Das kann ich nicht beurteilen. Aber nach meinem Gedankenexperiment weiter oben habe ich eher die Vermutung, dass sie weniger Nähe, Bestätigung, Aufmerksamkeit, Interesse, Empathie und Zuneigung durch Sex kompensieren müssen. Sex ist nur eine unter sehr vielen Möglichkeiten sozialer Interaktion – und damit für Frauen (zumindest die Zeit, bis sich eine wirklich passende Gelegenheit bietet) durchaus verzichtbar.
* Regenbogenfamilien sind hier bewusst nicht erwähnt (und auch nicht mitgemeint), weil sich die Problematik dort (meinem Eindruck nach) seltener stellt oder besser gelöst werden kann.
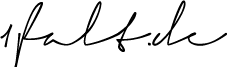
liebe 1falt,
wir sind ja jetzt blogfreundinnen. deinen artikel finde ich interessant. das mit der emotionalität der geführten debatten zum thema „geschlechterdifferenz“ liegt, glaube ich daran, dass sich davon einfach alle menschen unmittelbar und fundamental betroffen fühlen. mehr als bei anderen themen. außerdem soll da gerade einiges an macht verschoben werden und verschiebt sich. da werden manche/frauche ein bisschen unruhig. anders kann ich mir einfach nicht erklären, dass so viele unsere tollen argumente einfach ablehenen und das auch noch auf so unfreundliche weise.
das mit der frage „wie wäre ich, wenn ich ein mann wäre“, finde ich interessant. ich kann mir nicht vorstellen, dass ich als mann irgendwie anders wäre – oder anders wahrgenommen würde. ich wär natürlich echt zu klein :-). vielleicht fehlt mir da einfach die phantasie – müssen wir mal irl drüber plaudern. (hier he – hast de die internet-fachsprache bemerkt?
Hallo liebe Blogfreundin!
In meiner Vorstellung wärst Du sehr stimmig – so als Mann – ein tatsächlich ziemlich kleiner Mann, aber durchaus überzeugend. Wahrscheinlich würden wir doller (und vor allem lauter!) miteinander streiten. Denn aus aktuellem Anlass muss ich mir gerade eingestehen, dass ich auf Männer sehr viel schneller wütend werde … 🙂